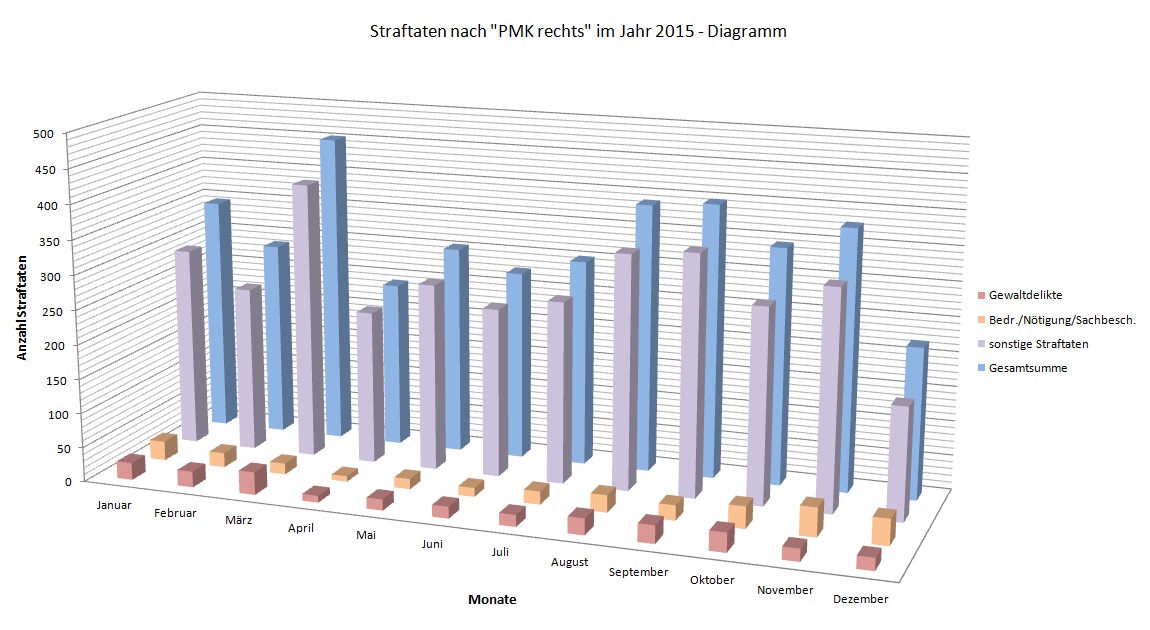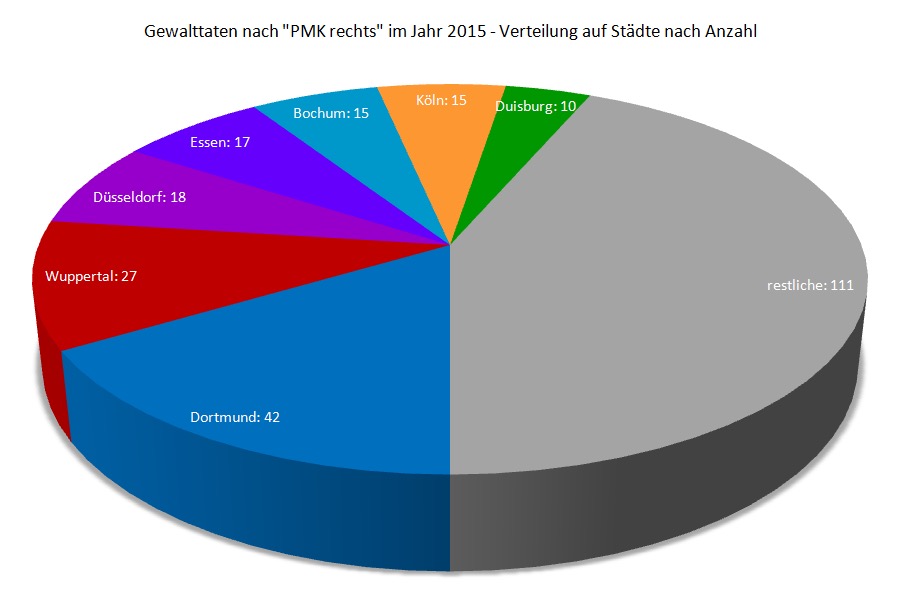Über das (notwendige) Erlernen von Widerstand
„Leider ist es eine typisch deutsche Eigenschaft, den Gehorsam schlechthin für eine Tugend zu halten. Wir brauchen die Zivilcourage, ‚Nein‘ zu sagen.“
(Fritz Bauer)
Am Pfingstwochenende waren in Berlin für eine kurze Zeit mehrere Objekte, die zum Teil bereits seit Jahren leerstehen, besetzt worden.
Ein guter Zeitpunkt, um nun zum zweiten Teil des Textes („Warum brennt hier eigentlich nicht alles…?“) zu kommen.
Die bereits im ersten Teil angerissenen Fragen zu Transparenz, Ungleichheit, dem Gefühl von abgehängt sein und der oftmals daraus resultierenden Ohnmacht, sein Leben selbstbestimmt leben zu können, bringen für jedes Individuum die Problematik hervor, wie man nun mit diesen Gefühlen umgehen könnte. Es ist sinnvoll und erstrebenswert, Ohnmacht zu durchbrechen und den Versuch im Kleinen und im Großen und mit anderen zusammen zu wagen, Momente und Räume zu schaffen, die das Gefühl von Selbstwirksamkeit mindestens in kurzen Phasen ermöglichen.
Der Staat hat im Allgemeinen wenig Interesse, solche Augenblicke zuzulassen, denn es ist nicht im Sinne eines Staates, dass Menschen in größerer Anzahl gegebene Strukturen und Unterdrückungsmechanismen hinterfragen oder gar abseits gesellschaftlich geschaffener und geduldeter Protestfolklore eigene Wege des Widerstandes suchen. Es liegt daher auch in der Natur des Staates und seiner gerne autoritären Anhängerschaft, solche Versuche nicht nur rigide und mit allen Mitteln von Gewalt und Repression zu unterbinden, sondern auch Überwachung zu etablieren, die (unter dem Deckmantel von Sicherheit) jedwede Organisierung im Vorfeld ausspionieren vermag.
Umso mehr ist es eine Frage der Überwindung eigener Schranken im Kopf, diese eventuell anerzogene Hörigkeit gegenüber gesellschaftlichen Gegebenheiten zu reflektieren und eigene Vorstellungen von Legitimität zu diskutieren und zu entwickeln.
Sehnsucht nach Autorität
Wir erleben in den sozialen Medien live mit, wie um Deutungshoheit gerungen wird. Machen wir uns nichts vor: Zunächst mal wird bei Vorfällen aller Art (Aktuelle Beispiele Erlwangen, Hitzacker) gerne einfach nur der Polizeibericht kopiert. Nahezu unkommentiert und unhinterfragt. Weiterhin wird dann zumeist aus konservativer und noch rechterer Ecke gerne noch mehr gefordert. Nicht nur Rechtsstaat, sondern am besten gleich erschießen.
Woher kommt das eigentlich alles? Der Glaube, Polizei sei neutral und kein politischer Akteur?
Woher kommt im weiteren Verlauf dann die Gnadenlosigkeit? Dieser Wunsch nach Härte und Autorität? Über-Ich? Identifikation mit dem Aggressor? So ein „Die werden schon was gemacht haben“? Ist es irgendwie die vage Hoffnung, am Ende nicht zu denen zu gehören, die es erwischt?
Oder woher kommt die doch erschreckend weit verbreitete Auffassung, Gesetze seien per se richtig?
Ein großer Teil progressiver Veränderungen von Gesellschaft ist keinesfalls ohne Auseinandersetzungen erstritten worden. Heute macht man lieber bunten CSD statt sich an den Hintergrund des keinesfalls gewaltlosen Stonewall-Aufstandes zu erinnern. Aber auch der 1. Mai geht nicht auf friedliche Auseindersetzungen zurück (Stichwort: Haymarket Riot). (Übrigens alles auch im Zusammenhang mit Polizeigewalt zu betrachten.) Ähnlich verhält es sich mit dem Frauenwahlrecht. Es ist daher eine durchaus gefährliche Verdrehung von Geschichte, überall in der politischen Debatte den Narrativ der Gewaltlosigkeit aufrecht erhalten zu wollen.
Widerstand üben?!
Gerade mit unserer Historie und angesichts der aktuellen Entwicklungen zu einem ausgeweiteten Polizeirecht, was man als autoritär und als Teil des Rechtsrucks begreifen sollte, ist es mehr als notwendig, Widerstand zu üben. Unsere Erziehung, unsere Sozialisation hat uns in den meisten Fällen irgendwie beigebracht, Autoritäten zu gehorchen. Und auch die aktuelle Gesetzgebung hat sehr offensichtlich das vorrangige Ziel, Menschen vor allem zum Gehorsam zu erziehen. Sei es durch Paragrafen wie 113/114 StGB oder durch Ausbau von möglichst lückenlose Überwachung aller bis in die privatesten Bereiche. (Kurzer Exkurs: Fällt euch irgendein Gesetz ein aus den letzten 70 Jahren, was den Schutz von Menschen vor dem Staat verbessert hat? Was sagt das aus, dass man da wirklich lange ohne Ergebnis grübelt? Und warum machen das doch erschreckend viele Bürger*innen ohne zu Zucken oder gar mit Begeisterung mit? Da kommt das Schüren von Angst vor Terror doch gerade recht.)
Aber zurück zum Lernen von Widerstand:
Jetzt will ich hier natürlich nicht zu Straftaten aufrufen. Aber es ist immer sinnvoll, Regeln zu hinterfragen und seinen eigenen Kompass nicht daran auszurichten, was Gesetz ist, sondern daran, was welche Werte abbildet.
Guckt euch um, wenn ihr Gruppen/Versammlungen/Aktionen beurteilt: (frei nach Judith Butler: Welche Utopie hat eine Gruppe/Versammlung? In was für einer Gesellschaft sieht diese Gruppe sich im Idealfall in 15/20 Jahren?)
Und weitergehend muss ich die Frage auch einzeln für mich stellen: In welcher Gesellschaft möchte ich leben? Wie möchte ich, dass Menschen miteinander umgehen? Was kann ich beitragen für mehr Gerechtigkeit/gegen Ungleichheit/gegen Armut/für eine lebenswerte Umwelt etc.? Was bedeutet Solidarität für mich? Und jetzt vor allem praktisch: Wie und in welchem Umfang kann ich wo Solidarität praktisch leben? Das kann von Foodsharing bis zum Verhindern von Abschiebungen gehen. Das kann das Anmelden einer Versammlung zum Schutz anderer sein (zum Beispiel bei einer Besetzung). Oder jemandem beizustehen gegen rassistische/sexistische Sprüche in der Bahn. Wie kann ich lernen, meinen Aktionsradius zu vergrößern? Welche Regeln breche ich wo mit welchem Ziel? (Rein praktisch ist schon das Anbringen eines Stickers an eine Laterne regelwidrig. Das muss aber auch bedeuten, sich mit Folgen von Repression auseinanderzusetzen.) Von welchen Menschen/Gruppen kann ich lernen? Wozu brauche ich überhaupt irgendwelche „Autoritäten“ (Parteien, Polizei etc.)? (Wo gebe ich dadurch eigene Verantwortung auf?) Wie können wir Konflikte lösen, ohne den Staatsapparat einzubeziehen oder irgendwelche „Autoritäten“? (Diese Fragen können nur Anregung sein und sind niemals abschließend. Stellt eure eigenen Fragen (oder ergänzt gerne in den Kommentaren.))
Zum Schluss:
„Leute, die durch Geld und Kanonen vor der Wirklichkeit geschützt sind, hassen die Gewalt zu Recht und wollen nicht einsehen, dass sie Bestandteil der modernen Gesellschaft ist und dass ihre eigenen zarten Gefühle und edlen Ansichten nur das Ergebnis sind von Ungerechtigkeit, gestützt durch Macht. Sie wollen gar nicht wissen, woher ihre Einkünfte stammen. Zugrunde liegt der unbequeme Umstand, der so schwer wahrzusagen ist, dass die Rettung des Einzelnen nicht möglich ist, dass wir gewöhnlich nicht zwischen Gut und Böse zu wählen haben, sondern zwischen zwei Übeln. Man kann die Welt von den Nazis beherrschen lassen, das ist ein Übel; oder man kann sie durch Krieg überwältigen, und das ist auch ein Übel. Eine andere Wahl steht uns nicht offen, und was immer wir entscheiden, wir werden nicht mit sauberen Händen davonkommen.
Der Unterschied, auf den es wirklich ankommt, ist nicht der zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit, sondern zwischen der Neigung zur Machtausübung und der Abneigung dagegen.“ (Orwell)